Die NeuroAffektive Persönlichkeitentwicklung (NAP) ist eine Art sehr detaillierter Landkarte für die Stadien der Entwicklung des menschlichen Gehirns und der Persönlichkeitsreifung, d.h. der emotionalen Entwicklung. Dieses Modell hilft mir als Therapeutin dabei, mit einem Menschen genau so zu arbeiten, dass ich ihn wirklich dort abhole, wo er sich in Bezug auf seine emotionalen Fähigkeiten befindet.
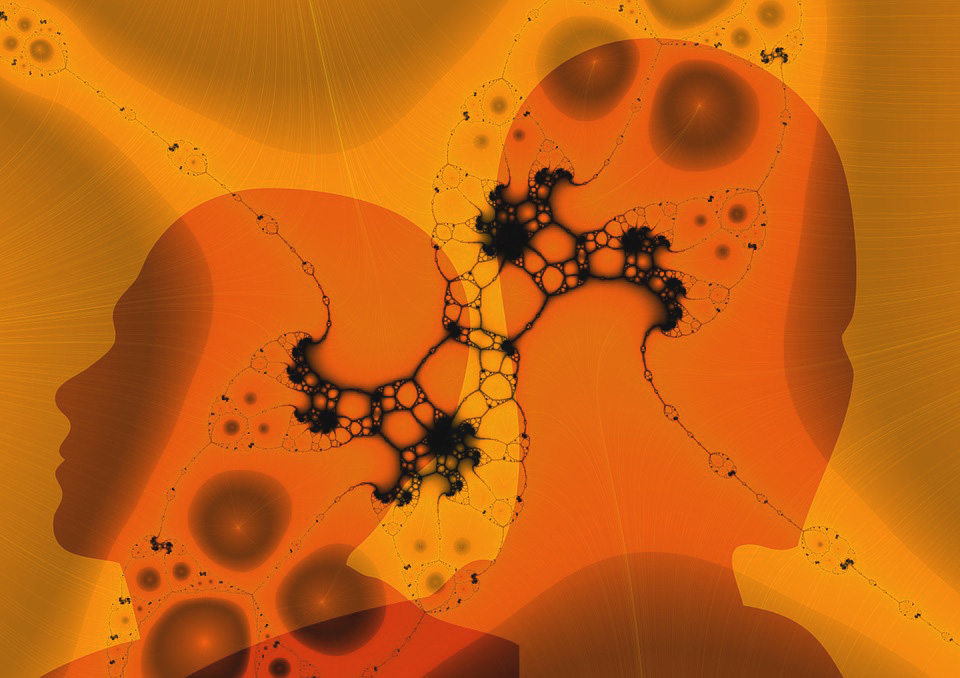
Oft wird versucht, mit Menschen zu arbeiten, die bestimmte Fähigkeiten nie entwickelt haben, indem man Werkzeuge nimmt, die für die Arbeit mit Menschen entwickelt wurden, die zunächst diese Fähigkeiten erworben und später Traumata erfahren haben. Das bricht mir das Herz.
– Marianne Bentzen, Seminaraufzeichnung 2017
Die dänische Psychotherapeutin Marianne Bentzen unterrichtet seit über 20 Jahren im Umfeld der Körperpsychotherapie. Sie hat sich in den letzten Jahren stark mit dem Thema Bewusstsein auseinandergesetzt. Erforscht hat sie es vor allem in den Bereichen "Psychomotorische Entwicklung", "Neuropsychologie“, "Trauma-Theorie" und "Spirituelle Komponenten". Sie hat zusammen mit Peter Levine Schriften verfasst und gemeinsam unterrichtet – u.a. die Fortbildung "Sexual Healing". Darüber hinaus ist Marianne Bentzen eine wundervolle, weise Meditations- und Achtsamkeitslehrerin.
Zusammen mit ihrer langjährigen Kollegin und Freundin Susan Hart hat sie mit NAP ein therapeutisches Modell erschaffen, das sowohl auf den verfügbaren Ergebnissen der modernen Entwicklungsforschung (Sanders, Tronick, Trevarthen, Stern) und der Neurobiologie als auch auf klinischer Praxis beruht.
NAP hilft mir als Therapeutin und als Mensch, herauszufinden: An welchem Punkt seiner emotionalen Entwicklung ist der Mensch, mit dem ich es zu tun habe, aufgehalten worden?
Dies zu erkunden und mich genau auf diesen Punkt so einzustimmen, dass ich meinem Gegenüber dabei behilflich sein kann, den nächstmöglichen Entwicklungsschritt zu gehen (anstatt etwas anzubieten, was momentan einfach noch zu viel ist und Frustration oder gar Beschämung auslösen würde), ist das Anliegen von NAP.
Ein bisschen Theorie dazu:
Die gesunde emotionale Entwicklung eines Kindes geschieht in Schritten, die hierarchisch aufeinander aufbauen. Sie hängt entscheidend davon ab, welche gemeinsamen Rhythmen die Hauptbezugsperson(en) und das Kind entwickeln (Schlafen, Wachsein, Füttern etc.) und wie ihr Zusammensein sich gestaltet.
Die Atmosphäre, in der wir aufwachsen, prägt unsere Entwicklung
Kann die Bezugsperson das Kind, wenn auch nicht immer, so doch in vielen Momenten erspüren? Kann sie sich auf das Kind und seine Bedürfnisse einstimmen? Ist sie in der Lage, Fehleinstimmungen (die völlig normal sind) liebevoll zu korrigieren? Kann sie gut mit den Bedürfnissen des Kindes umgehen? Kann sie dem Kind ein zärtlicher Spiegel sein, so dass es ganz allmählich lernt, sich selbst und sein Erleben zu begreifen? Und irgendwann zu begreifen, dass die Bezugsperson nicht eins ist mit ihm, sondern ein eigenständiges Wesen? Kann die Bezugsperson freudige Erregung oder Neugier des Kindes teilen? Kann sie mitfühlen, wenn ihr Kind es gerade schwer hat, ohne selbst zu verzweifeln, wütend zu werden oder sich abzuwenden? Kann sie ihr Kind ermutigen, etwas Neues auszuprobieren – ohne es zu überfordern? Wir machen bestimmte Interaktionserfahrungen und daraus werden bei uns Erwartungen geweckt. So entstehen Bindungsmuster. Haben wir als Kind sichere Bindung erlernen dürfen? Auf viele von uns trifft das leider nicht zu.
Bevor ein Kind bestimmte Fähigkeiten nicht verlässlich erlangt hat, kann es den nächsten Entwicklungsschritt und alle darauffolgenden Schritte nicht gehen.
Die ersten Erfahrungen eines Menschen sind Körpererfahrungen
Die Fähigkeit zur Regulation von Gemüts- und Körperempfindungen ist grundlegend für die darauffolgende Entwicklung von Gefühlen und das Vermögen zu mitfühlendem Austausch mit anderen. Diese Selbstregulationsfähigkeit ist das Ergebnis unzähliger „mikroskopischer Augenblicke gegenwärtigen Erlebens“ (Bentzen und Hart) zwischen Bezugsperson und Kind.
Gefühle entstehen, wenn uns etwas vorübergehend aus der Balance bringt. Z.B. weil es uns froh stimmt, weil wir etwas als gefährlich empfinden, weil uns etwas zurückweichen lässt oder weil wir Begeisterung erleben.
Wird dem Kind vermittelt, dass jedes seiner Gefühle sein darf?
Nimmt die Bezugsperson Anteil an den Gefühlen des Kindes?
Wenn wir in der Lage sind, Wut, Gereiztheit, Traurigkeit, Verspieltheit, Eifersucht usw. zu fühlen, dann ist das so, weil jemand das alles mit uns durchgespielt hat. Z.B. entdecken wir, dass Trauer etwas ist, was wir bewältigen können, erst dann, wenn jemand kommt und uns tröstet. So haben wir ein Gefühl für unsere eigene emotionale Einsicht bekommen. Oder eben oft auch nicht.
Wir sind alle dazu geboren, am Nervensystem des anderen teilzuhaben – Daniel Stern
Ob uns solche wundervollen Augenblicke gegenwärtigen Erlebens als ganz kleine Wesen mit unseren Bezugspersonen ganz regelmäßig vergönnt waren, entscheidet heute in großem Maße mit darüber, ob wir in der Lage sind, unsere Impulse zu kontrollieren.
Unsere Erfahrungen formen unser Gehirn
Ob wir die Fähigkeit entwickeln konnten, Einsicht in uns selbst und andere zu gewinnen, hängt davon ab, ob wir im Kontakt mit unserem Körper sein können, uns also im eigenen Körper wirklich zuhause fühlen – den Körper als einen guten Ort erleben. Und davon nun hängt es ab, ob es uns möglich ist, im Zusammenspiel mit anderen gemeinsam einen Rahmen der Sicherheit zu erschaffen und uns auf das Gegenüber einzulassen.
Emotionale Reife hat etwas mit mutiger Verletzlichkeit zu tun: Wir erlauben den Geschehnissen, auf uns einzuwirken, nehmen sie jedoch nicht persönlich. Damit haben viele Menschen große Schwierigkeiten, denn der gesunden Reifung ihres Gefühlslebens stand von Anfang an Vieles im Wege. So gehen manche Erwachsenen später mit der Frage durch ihr Leben: Wie geht eigentlich Beziehung? Wie geht Kontakt zu anderen Menschen? Im Grunde genommen sind viele von uns sehr verunsichert in der Begegnung mit anderen und oftmals voller Scham über die empfundene Unzulänglichkeit. Nicht wenige Menschen haben, um die vernichtende Wucht der Scham nicht ständig fühlen zu müssen, Kompensationsstrategien entwickelt, die es so aussehen lassen sollen, als wären sie hochkompetent im Kontakt mit anderen. Oder als bräuchten sie andere Menschen überhaupt nicht. Statt der Scham vermitteln diese Kompensationsstrategien oft ein Gefühl von Stolz, das allerdings auf tönernen Füßen steht: Z.B. „Ich bin stolz darauf, niemanden zu brauchen!“, „Ich bin stolz darauf, dass ich mir von niemandem etwas sagen oder gefallen lasse!“ „Hauptsache, ich verdiene richtig viel Geld. Dann geht es mir gut. Ich bin stolz darauf, mir alles kaufen zu können, was ich will.“… Wenn solch ein Stolz zusammenbricht, kann es sich richtig lebensbedrohlich anfühlen.
Zu diesen Kompensationsstrategien gehören z.B. auch Schuldzuweisungen. Wenn wir anderen die Schuld zuweisen, müssen wir selbst die Scham, die Verletztheit, den Groll, die Wut, die Traurigkeit ... nicht empfinden. Auch Vertuschen gehört dazu, das Schüren von Angst, Machtspiele, Manipulation, Ausgrenzung, Rückzug, Abprallen lassen, Zynismus, Sucht, Schikane Schwächerer, zwanghafte Sorgen, Perfektionismus, Gewalttätigkeit u.v.m.
Indem wir unser Gehirn verändern können,
können wir unser Leben ändern
Die gute Nachricht ist: Unser Gehirn ist bis ins hohe Alter formbar. Das nennt sich Neuroplastizität. Alles, was wir regelmäßig tun und kultivieren, im Positiven wie im Negativen, sorgt dafür, dass die Nervenbahnen, die dabei aktiv sind, kräftiger werden. Nervenbahnen, die wir regelmäßig gleichzeitig benutzen, lernen es, sich zu bündeln und zukünftig gemeinsam anzuspringen. Zum Beispiel läuft uns das Wasser im Mund zusammen, wenn wir an unsere Lieblingsspeise denken. Und wir können das Gericht geradezu schmecken. Und wenn wir Fotos vom Urlaub am Meer anschauen, können wir vielleicht wieder die salzige Luft riechen, die Wellen und die Möwen hören, die Sonne oder den Wind auf der Haut spüren ... Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist es, meinen Patienten zu helfen, positives Erleben während der Therapiestunde bewusst zu erleben und im Körper zu verankern. Das Erleben muss dafür nicht spektakulär sein.
Bestimmte Gemütszustände unterbinden und schwächen andere Gemütszustände. Z.B. ist es so, dass wir jedes Mal, wenn wir Neugier erleben, gleichzeitig Trauma-, Angst- und Schwächemuster entkräften. Das lässt sich wunderbar nutzen.
Unser Gehirn lernt immer dann, wenn etwas Neues passiert
Dieses Neue kann etwas vermeintlich ganz Kleines sein. Etwas, was zwischen Therapeutin und Patientin oder Patient geschieht. Vielleicht ein Gefühl des Soseindürfens bei einer Gefühlsäußerung, die bis dahin immer als belastend erlebt wurde, weil da die Befürchtung war, sie könnte das Gegenüber überfordern. Die Erfahrung vielleicht, dass da jemand ist, der vor Traurigkeit oder Wut nicht zurückschreckt. Zu erleben, dass ein „Nein!“ respektiert wird. Oder ein Moment des bisher ungekannten Körpererlebens. Ein Gefühl von Gesehenwerden. Ein geteiltes Lachen. Geduld beim Gegenüber. Ein Aha-Moment. Ein Moment des gemeinsamen Ausprobierens oder des Verspieltseindürfens. Vielleicht ein Moment der Sicherheit darüber, dass genug Zeit da ist, um ein Gefühl in der Tiefe zu erforschen. Und dass es in Ordnung ist, sich die Zeit zu nehmen. Langsam zu sein. Ohne ein bestimmtes Ziel. Denn es geht um den Prozess selbst. Um das Erleben, das im Laufe der Zeit immer feiner werden darf. Nur so geschieht echte Veränderung.
Gute Therapeuten verfügen immer über eine Möglichkeit, herauszufinden, wie sie in einer konkreten Situation am besten vorgehen, doch nicht ihre Methode initiiert die entscheidenden, tiefreichenden, persönlichkeitsverändernden Prozesse. Die Methode legt den systematischen Gebrauch bestimmter „Werkzeuge“ nahe und bietet eine Struktur für die Makroregulation an. Sie besteht aus den konkreten Werkzeugen und Prinzipien, die zur Einleitung von Transformationsprozessen erforderlich sind, was dem Komponieren in der Musik ähnelt.
Rhythmus, Tempo und interaktive Sensibilität für Mikroregulationen in einer Therapiesitzung könnte man mit sich wiederholenden und weiterentwickelnden musikalischen Themen vergleichen, und ebenso wie in der Musik gibt es auch hier plötzliche Offenbarungen, die zu neuartigen Erlebnissen bedeutsamer Zustände des Selbstempfindens führen. Die Mikroregulation im Kompositionsprozess stimuliert die emotionalen Strukturen des Gehirns und initiiert Entwicklungen.
– Bentzen und Hart in „Neuroaffektive Therapie mit Kindern und Jugendlichen“

